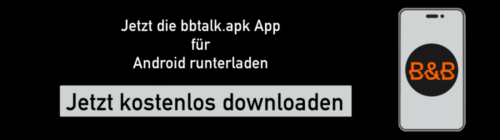Rette sich wer kann Sven Böttcher
Rette sich wer kann Sven Böttcher - eine persönliche Geschichte
Rette sich wer kann Sven Böttcher : „Dass wir sogar zum Sterben ins Krankenhaus gehen, spricht in Sachen Enteignung Bände. Im Krankenhaus sind Ärzte – also jene Leute, denen wir lebenslang unsere Gesundheit, diese eigentlich »autonome Kraft der Lebensbewältigung«, wie Illich sie nennt, übertragen haben.
Es ist daher nur konsequent, dass wir bis zum letzten Atemzug nicht zurückfordern, was uns gehört. So halten wir denn stur an der Illusion fest, diese Halbgötter hätten je irgendetwas zu unserer Gesundung beigetragen – und vertrauen auch nun, zum traurigen Schluss, blind darauf, sie könnten bestimmt auch auf diesem letzten Stück des Wegs irgendwelche Wunder wirken. Dass die Hospitalisierung das Leben nicht verlängert, nehmen wir nicht zur Kenntnis.
Mühelos ignorieren wir, dass man im Krankenhaus nicht länger überlebt als Zuhause – eher kürzer, wegen der Gefahren durch resistente Keime. Krebs im Endstadium? Dauert im Krankenhausbett auch nicht länger als im eigenen. Warum also gehen wir da hin? Um auf den letzten Metern wenigstens noch mal richtig schlecht zu essen? Oder gehen wir ins Krankenhaus, um andere nicht zu behelligen, unsere gesunden Verwandten und Freunde? Oder schicken uns diese anderen dorthin, mehr oder weniger sanft, weil sie nicht von uns behelligt werden möchten mit unserem ultimativen Versagen, unserem Sterben?
Man kommt der Antwort näher, wenn man sich an die eigene Nase fasst und sich fragt, wie man selbst zum Sterben der anderen steht. Ob man das erleben möchte, aus der Nähe, oder lieber nicht. Lieber ganz dringend nicht. Ob man dieses Verhalten der anderen nicht als zutiefst verstörend empfindet, weil es so unfassbar unhöflich ist. Wie soll man selbst denn weiter stillschweigend so tun, als sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Tod an sich besiegt ist von Wissenschaft und Medizin, wenn dieser verfluchte Tod direkt vor den eigenen Augen jemand holen kommt? Nicht auszuhalten.
Rette sich wer kann Sven Böttcher - Leseprobe 2
Nicht für den, der jeden Gedanken an den Tod ausgeklammert hat als störend, als lästig, als Optimierungs- und Spaßbremse. Schafften wir uns unsere Sterbenden nicht aus den Augen, aus dem Sinn, stünden viel zu viele unerträgliche Fragen unausweichlich im Raum: Wie stehe ich zum Tod? Dem Sterben der anderen? Wie zu meinem eigenen? Wie stehe ich überhaupt zu Schwäche? Zu der anderer? Wie zu meiner eigenen? Empfinde ich Mitgefühl, wenn einer schwach ist und krank, eile ich los, um zu helfen?
Oder empfinde ich eher Abscheu?
Und ist es denn nicht wahr, ist nicht jeder seines Glückes oder Unglückes Schmied?
Warum behelligt der Schwache mich mit seiner Inkompetenz?
Warum der Sterbende?
Der Fragenkatalog wird rasch umfangreicher, wenn man nicht schleunigst das Weite sucht. Denn wer fragt: »Wie stehe ich zum Tod, wie verstehe ich den Tod?«, stolpert wohl umgehend auch über die
Frage: »Wie verstehe ich Leben? Was verstehe ich unter Leben?« Und weil unser sich sträubender Denker hier, im Krankenhauszimmer, unter Sterbenden, meist betagten Sterbenden, gar nicht anders kann, fragt er sich wohl auch: »Was halte ich für lebenswert? Ich selbst? Ich möchte nie sterben. Ich werde mindestens 110 Jahre alt. Bei bester Gesundheit! Und all meine Freunde auch! Und mit 109 fange ich mal an, Bilanz zu ziehen. Oder so.
Nichts wie raus hier.« Natürlich muss unser spätestens an dieser Stelle Hals über Kopf aus Hospital und Relevanz flüchtender Wirklichkeitsverweigerer die gemeinen Fragen ersticken. Denn tatsächlich bekäme es ihm nicht, wagte er sich auch nur einen Schritt weiter. Ihm steht tatsächlich nichts zur Verfügung, womit er sich an die letzten Fragen herantrauen könnte.
Rette sich wer kann Sven Böttcher - Leseprobe 3
Er hat kein Konzept, er hat kein Werkzeug. Er ist aufgeklärt, er hat alle Illusionen hinter sich gelassen. Gott ist tot (wissenschaftlich erwiesen, bestimmt) – der und all seine Götter-Vorgänger waren doch nur frei erfundener Unsinn von Höhlenmenschen und Naiven, es gab kein Vorher, es gibt kein Nachher, es gibt keinen Himmel, keine Hölle, keine ewigen Jagdgründe, kein Nirwana, keine nächste Runde als Regenwurm oder Sonnenblume. Der Sinn des Lebens ist – na, eben, leben, fertig! Was sind denn das überhaupt für bescheuerte, sinnlose Fragen?
Man wird geboren, man macht was, man hat möglichst viel Spaß, man hat vielleicht Kinder oder auch nicht (»keine Kinder« ist echt entspannter), und dann, na ja. Dann, irgendwann, möglichst spät. Ist halt so, muss man aber nicht drüber nachdenken, kann man eh nicht ändern.
Na, das ist doch mal eine gediegen fantasielose Antwort. Wenn Stubenfliegen sprechen könnten, wären sie wohl einverstanden. Aber der Mensch ist doch, anders als die Fliege, gesegnet mit allerlei Talenten, unter anderem mit einem Gehirn, mit Verstand, mehr oder weniger. Auch wenn dieser Verstand ein mehrschneidiges Schwert ist, kommt der Verstandesbegabte doch um die Frage kaum herum, wieso er denn überhaupt lebt? Zur Arterhaltung wird er garantiert nicht benötigt – ob mit oder ohne Kinder, denn wir sind mit 7,5 Milliarden sehr weit auf der sicheren Seite.
Als Klimaschädling braucht ihn ebenfalls niemand, und da er auf Schwäche und Hilflosigkeit nicht mit Empathie und Ich-spende-alles-was-ich-habe reagiert, sondern generell mit Flucht in das nächstgelegene Shopping-Paradies: Wozu lebt dieser Mensch? Und wozu will er dann obendrein auch noch lange leben? Länger als 40 Jahre oder 60 gar? Die Antwort aller Pragmatiker, die stolz sind, sämtliche Götter als Mythen und Legenden entlarvt zu haben, wurzelt eigenartig tief im Religiösen.
Rette sich wer kann Sven Böttcher - Leseprobe 4
Sie wissen zwar nicht, wozu sie da sind und welchen tieferen Sinn ihre Existenz hat oder haben könnte, sind aber überzeugt, das sei schon so gewollt. Wäre es nicht, wären sie ja nicht, quod erat demonstrandum. Das Leben ist doch wohl ein Geschenk. Und wer es hat, darf es dann auch behalten. Ja, wer es geschenkt bekommen hat von wem auch immer – nur nicht den Göttern, die gibt es ja nicht –, ist sogar verpflichtet, es zu behalten, möglichst lange, denn es kommt ja von wem auch immer das jetzt kommt, das Leben.
Jedenfalls ist das per se gut, so ein Leben – das darf sich auch niemand nehmen. Und es ist schützenswert. Bis zuletzt! Gleichermaßen schützenswert. Jedes Leben.
Das Leben eines Fünfjährigen mit Lungenentzündung ebenso wie das einer hundertdreijährigen Krebskranken im Halbkoma. Sofern die Hundertdreijährige allerdings so vorausschauend clever war, sich in Leverkusen gebären zu lassen, und der Fünfjährige so blöd, sich eine syrische Mutter auszusuchen – tja, Junge, Augen auf beim Geborenwerden –, relativiert sich unser »gleichermaßen schützenswert« dezent zu seinen Ungunsten. Können wir sie trotzdem mal kurz befragen, die Leverkusener Dame im Chemo-Morphium-Nebel, wieso sie noch da ist und sich das antut?
Hat sie eine Antwort außer: »Weil man doch leben muss?« Muss man? Egal, wie? Nur: möglichst lange? Und wozu? Wozu noch weiter? Und wozu überhaupt? (Übrigens, Vorsicht, vielleicht hat die gute Dame ja doch schon mal nachgedacht und würde, fragte man sie, antworten: »Weil ihr mir keinen sanften Ausweg lasst, ihr hirn- und herzlosen Monster!«)“